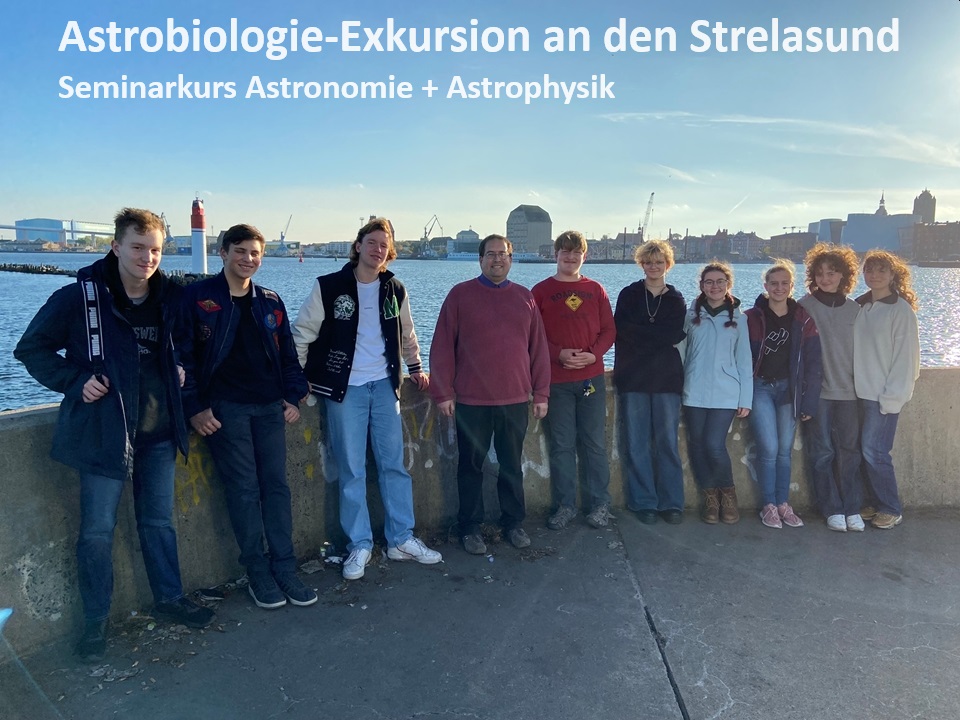In der GOST belegen die Schülerinnen und Schüler einen zweijährigen Seminarkurs, in dem überfachliche Kompetenzen gefördert und gefordert werden sollen. Exemplarisch wird an ausgewählten Fachinhalten wissenschaftspropädeutische Bildung vermittelt bzw. Berufswahl‐ und Berufsweltkompetenz entwickelt.
Der Link zur Publikation des LISUM "Handreichung „Hinweise zum Unterricht. Der Seminarkurs in der gymnasialen Oberstufe“ https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/berufs-_und_studienorientierung/seminarkurs/Seminarkurs_ergaenzte_Fassung_Januar_2015.pdf
Seminarkurs 1: New Hollywood (Hr. Dr. Möllmann)
Es ist die Zeit eines Umbruchs in der US-amerikanischen Kultur und Gesellschaft: Die jüngere Generation distanziert sich von der Lebensweise der Eltern und entwickelt eigene Lebensentwürfe, Proteste gegen den Vietnam-Krieg sowie grundsätzliche Zweifel an der herrschenden Klasse kennzeichnen das politische Klima. Und es entsteht gegen Ende der 60er-Jahre in den USA eine neue Filmbewegung, die gerade diese Themen aufgreift und mit innovativen filmischen Mitteln umsetzt: New Hollywood.
Der Seminarkurs möchte diese besondere Ära in der amerikanischen Filmgeschichte (ca. 1967-1976/1980) vor dem Hintergrund des oben skizzierten gesellschaftlichen Wandels näher beleuchten.
Ausgehend von dem Film Die Reifeprüfung ([The Graduate] USA 1967, Regie: Mike Nichols) soll der Kurs zugleich als eine Einführung in die systematische Filmanalyse dienen und damit den Schülerinnen und Schülern schließlich die Möglichkeit zur Untersuchung selbst ausgewählter Filme aus dieser Ära bieten, die heute vielfach als Klassiker gelten (z. B. Der Pate, Easy Rider, Taxi Driver, Apocalypse Now).
In wissenschaftspropädeutischer Hinsicht wird hierbei insbesondere die Recherche von und die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher (Sekundär-)Literatur zum Rahmenthema bzw. zu einzelnen Filmen im Zentrum stehen.
Mögliche Themen für die Seminararbeiten (andere Themen sind durchaus willkommen):
- Untersuchungen einzelner Filme der New-Hollywood-Ära vor dem sozio-kulturellen Hintergrund ihrer Zeit
- Untersuchungen zu spezifischen Gestaltungsmitteln in Filmen des New Hollywood (z. B. in Bezug auf Darbietungsformen des Erzählens, die Bild- oder Tonebene)
- Vergleichende Untersuchung zweier thematisch verwandter Filme der New-Hollywood-Ära
- Vergleichende Untersuchung zwischen Classical- und New-Hollywood-Filmen als Angehörige des gleichen Genres (Western, Gangsterfilm u.a.)
- ...
Seminarkurs 2: Klimawandel (Fr. Herzig)
Die Wissenschaftsstadt Potsdam ist führend in der Klimaforschung. Die Mosaic-Expedition des Alfred Wegener Instituts (AWI) liefert Erkenntnisse über den Zustand des arktischen Meereises, das Potsdamer Instituts für Klimafolgeforschung (PIK) berät die Bundesregierung in Fragen des Emissionshandels und der CO2-Bepreisung zum Erreichen der Klimaneutralität und mit dem Friedensnobelpreis für den IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wurden die wissenschaftliche Leistung der Potsdamer Klimaforschung weltweit anerkannt. Im Seminarkurs Klimawandel wollen wir uns mit Fragen zum Klimawandel, dessen Folgen und den Möglichkeiten, die Klimaneutralität in Deutschland und der Welt zu erreichen, auseinandersetzen und darüber mit Wissenschaftlern aus Potsdam ins Gespräch kommen. Am 1. Juni 2022 wird Prof. Ottmar Edenhofer, der Leiter in einer Podiumsdiskussion den Schülerinnen und Schülern des Seminarkurses in einer Abendveranstaltung Rede und Antwort stehen.
Seminarkurs 3: Mensch- und Umweltbeziehungen – methodische und experimentelle Arbeitsweisen in der Geografie (Fr. Tsioura)
Der Seminarkurs beschäftigt sich mit Inhalten, die in Bezug zu den Erd- und Umweltwissenschaften (wie z. B. Geomorphologie, Geologie, Klimatologie, Ozeanographie) stehen, um das Verständnis für natürliche Prozesse sowie für sozioökonomische Handlungsweisen des Menschen zu fördern. Themen wie Klimawandel, Umweltprobleme, Erdbeben oder Naturkatastrophen werden auf lokaler, regionaler und globaler Ebene untersucht.
Der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) hat mit dem „Syndromkonzept“ eine Methode für die Betrachtung von Problemen im Umwelt-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturbereich entwickelt. Beispiele für die hier genannten Syndrome, wie für das Sahel-, Aralsee- oder Katanga-Syndrom, die vor allem im ersten Semester erarbeitet werden, dienen als Grundlage für das inhaltliche und wissenschaftspropädeutische Arbeiten in den folgenden Semestern.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen Arbeitsweisen in der Geografie. So werden außer den „üblichen“ geografischen Arbeitsmaterialien, wie Karten und Diagrammen, auch Luft- und Satellitenbilder analysiert. Außerdem werden Recherchen an verschiedenen Orten, wie Kartierungen oder Bodenproben mit dem Pürckhauer, durchgeführt.
Seminarkurs 4: Astronomie und Raumfahrt (Hr. Pagenkopf)
Im Seminarkurs Astronomie und Astrophysik vertiefen wir zunächst die Newton’sche Mechanik des Physikunterrichtes der Oberstufe. Wir wenden die Kepler’schen Gesetze an und berechnen die verschiedenen kosmischen Geschwindigkeiten. Die Erdbahnellipse sowie die Bahnen anderer Himmelskörper werden durch die Definition von Bahnelementen eindeutig beschrieben. Die Planetendefinition führt uns zum Aufbau, zur Entstehung und zur Entwicklung unseres Heimatsonnensystems. Unsere kosmischen Nachbarn im All lernen wir genauer kennen. Die am Herbstanfang 1846 in Berlin erfolgte Entdeckung des Planeten Neptun zeigt uns die Verzahnung von theoretischer und experimenteller Astronomie auf.
Die moderne astronomische Forschung setzt Weltraumteleskope und Raumsonden voraus. Seit gut 60 Jahren gibt die Raumfahrt hierzu die technischen Möglichkeiten. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Raumfahrt, hierbei wird in Bezug auf den Kalten Krieg auch eine Fächerverbindung zum Fach Geschichte hergestellt. Besonders interessieren uns hierbei die Raumfähren SpaceShuttle und Buran sowie Raumstationen und die Zukunft der Raumfahrt.
Die Himmelsscheibe von Nebra bringt uns über unser Sonnensystem hinaus zu den Sternen, Sternassoziationen und Galaxien. Wir lernen uns am Nachthimmel zu orientieren und die Sternbilder zu benennen. Ihre mythologische Bedeutung interessiert uns ebenso wir der kosmische Kalender für das bäuerliche Jahr. Die Entstehung von Sternen, deren Lebensweg und ihre Endstadien zeigen uns die Herkunft der chemischen Elemente auf. Mit der Kosmologie erschließen wir die übergeordneten Strukturen und die Zukunft des Alls.
Der Seminarkurs Astronomie und Astrophysik wird durch zahlreiche nur im Rahmen des Schulunterrichtes durchführbare Exkursionen bereichert. Neben Beobachtungen des Sternhimmels von Babelsberg aus besuchen wir die Potsdamer und Berliner Planetarien und Volkssternwarten. Das Leipniz-Institut für Astrophysik in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Schule wird mehrmals im Laufe des zweijährigen Kurses besucht. Geschichte und Technik der Raumfahrt bestaunen wir im Historisch-technischen Museum Peenemünde. Die Himmelsscheibe von Nebra erleben wir im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und in der Arche Nebra. Mit der jungen interdisziplinären Wissenschaft Astrobiologie und der sehr aktuellen Frage nach extraterrestrischen Leben in den Ozeanen der Eismonde Europa (Jupiter) und Enceladus (Saturn) befassen wir uns im Ozeaneum in Stralsund.
T. Pagenkopf